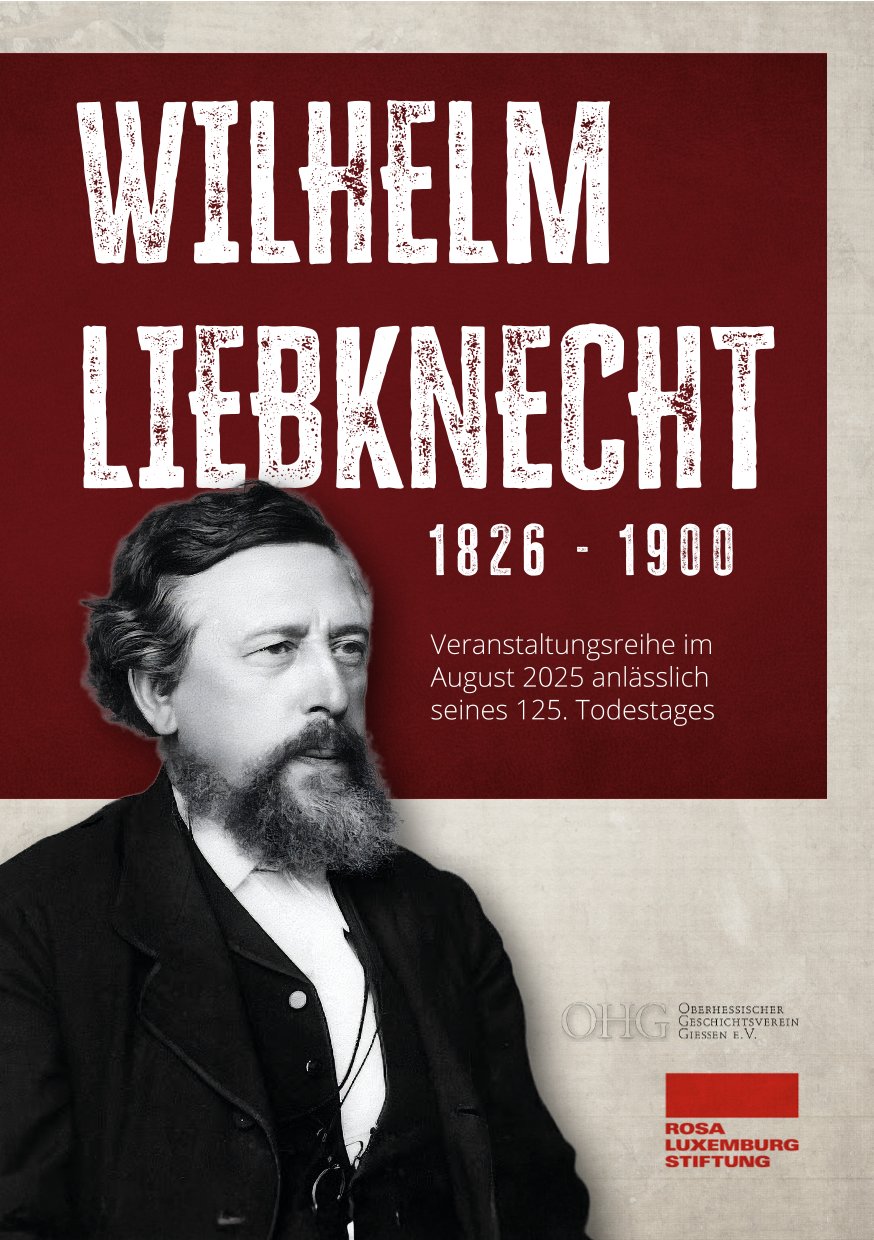100 Jahre »Acht-Stunden-Tag« Der lange Kampf

Zum 1. Januar 1919 wurde Realität, wofür die Arbeiterbewegung lange gekämpft hatte: der Acht-Stunden-Tag. Die Kämpfe um die Normierung der Arbeitszeit begleiten die Gewerkschaftsbewegung seit ihrer Entstehung; sie sind Ausdruck der inneren Bewegungsgesetze des Kapitalismus.[1]
In ihrem »Heißhunger nach Mehrarbeit« (Marx) laufen die Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände seit eh und je Sturm gegen die Begrenzung der täglichen Arbeitszeit. Im historischen Verlauf änderten sich nur die Argumente für die immer wieder erneuten Versuche der Aushebelung des Acht-Stunden-Tages.
Argumentierten die Vertreter der Schwerindustrie in den 1920er Jahren, »eine Arbeitszeit-verlängerung (sei) trotz höherer Arbeitslosigkeit aus Gründen der Kostensenkung und der deutschen Wettbewerbsfähigkeit unumgänglich«, polemisieren die Verbandslobbyisten heute, der Acht-Stunden-Tag sei ein Anachronismus im Zeitalter globaler Produktion und Rundum-Service: »24/7« lautet das Kürzel. Im Koalitionsvertrag der GroKo heißt es, man wolle »über eine Tariföffnungsklausel im Arbeitszeitgesetz Experimentierräume für tarifgebundene Unternehmen schaffen, um eine Öffnung für mehr selbstbestimmte Arbeitszeit der Arbeitnehmer und mehr betriebliche Flexibilität in der zunehmen digitalen Arbeitswelt zu erproben.«
Der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände reicht das nicht. BDA-Präsident Ingo Kramer: »Die deutsche Wirtschaft braucht mehr als bloße Experimentierräume, wir fordern mit Nachdruck ein grundlegendes Update des Arbeitszeitgesetzes.«[2] Doch was als »Modernisierung« ausgegeben wird, ist tatsächlich nichts anderes als das Verlagen nach einer großen Regression: zurück in die Geschichte – Zurückdrängung eines nur widerwillig und temporär eingegangenen Klassenkompromisses.
Rückblick: Der vom walisischen Sozialreformer Robert Owen geprägte Slogan »Acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen, acht Stunden Freizeit und Erholung« entwickelte sich vor über hundert Jahren zu einer der zentralen Forderungen der Arbeiterbewegung. 1866 forderte die »Internationale Arbeiter Assoziation« die gesetzliche Einführung des Acht-Stunden-Tages.[3] Drei Jahre später nahm die SPD die Forderung in das Eisenacher Programm auf und 1889 beschlossen die Delegierten des »Internationalen Arbeiterkongresses« in Paris, dass der »Acht-Stunden-Tag« gesetzlich eingeführt werden müsse.
Im Jahr 1903 streikten im sächsischen Crimmitschau Textilarbeiter*innen sechs Monate lang für den »Zehn-Stunden-Tag«. Mit ihrem Arbeitskampf begehrten sie gegen die Preußische Fabrikordnung auf, in der es hieß: »Die Arbeitszeit der Arbeiter, welches auch ihre Arbeiten sein mögen, wird vom Fabrikherrn nach den Umständen und der Jahreszeit bestimmt. Jeder Arbeiter ist verpflichtet, länger als gewöhnlich und auch sonntags zu arbeiten, wenn es die Umstände verlangen.«
In Folge der Novemberrevolution 1918 in Deutschland konnten die Organisationen der Arbeiter und Angestellten den Arbeitgebern im »Stinnes-Legien-Abkommen«[4] das Zugeständnis abringen, die Arbeitszeit – unter Garantie des vollen Lohnausgleichs – auf acht Stunden pro Tag zu verkürzen. Per Verordnung vom 12. November begrenzte dann der Rat der Volksbeauftragten die tägliche Arbeitszeit zum 1. Januar 1919 für alle Arbeitnehmer auf acht Stunden.
Doch schon fünf Jahre später bei der Verabschiedung der »Arbeitszeitverordnung 1923« beschloss die Reichsregierung auf Druck der Arbeitgeber weitestgehende Ausnahmen von der gesetzlichen Acht-Stunden-Regelung. In der Zeit der Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten wurden die meisten Arbeitszeit-Schutzvorschriften außer Kraft gesetzt und ab 1938 wurden durch Ausnahmeregelungen wieder Zehnstundentage zugelassen.
Nach dem Sieg über den Hitler-Faschismus setzte der »Alliierte Kontrollrat« in der Nachkriegswirtschaft die 48-Stunden-Woche wieder in Kraft. Als Anfang der 1950er Jahre die Wirtschaft zu boomen begann und die Gewinne der Unternehmen in die Höhe schnellten, forderten die Gewerkschaften einen angemessenen Anteil für die Lohnabhängigen am Aufschwung, also Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen: In Grundsatzprogramm des DGB von 1952 wurde die Forderung nach stufenweiser Durchsetzung der 40-Stunden-Woche an fünf Tagen in der Woche aufgenommen.
Was den Unmut des damaligen Wirtschaftsministers Ludwig Erhardt hervorrief: »Ein Volk, das auf breitester Grundlage den Wohlstand mehren und auch in Arbeitnehmerhand die Vermögensbildung fördern will. Ein Volk, das, um auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben, ständig hohe Investitionen vornehmen muss. Ein solches Volk sollte sich nicht Überlegungen nach Verkürzung der Arbeitszeit hingeben.« Am 1. Mai 1956 konterten die Gewerkschaften mit der Losung: »Samstags gehört Vati mir!« Es dauerte nahezu zehn Jahre, bis im Jahr 1965 das Ziel endlich erreicht war: die 40-Stunden-Woche an fünf Arbeitstagen
Die Wirtschaftskrise 1974/75 holte die Massenarbeitslosigkeit wieder in den Alltag der Bundesrepublik zurück. Insbesondere in der Eisen- und Stahlindustrie erfolgte ein schwerer Einbruch. 1978/79 kam es in dieser Branche zum ersten Arbeitskampf für die 35-Stunden-Woche unter dem Motto »Arbeitszeit verkürzen – Arbeitsplätze sichern und neue schaffen«. Nach fast sechs Wochen Streik kam Anfang Januar 1979 der Tarifkompromiss zustande: Neben einer Freischichtenregelung für Nachtschichtarbeiter und ältere Arbeitnehmer, der Erhöhung der Löhne und Gehälter um 4% wurde für alle Stahlarbeiter*innen in Stufen (bis 1982) 30 Tage Urlaub vereinbart.
Anfang der 1980er Jahre deuteten alle Prognosen darauf hin, dass bis zum Ende des Jahrzehnts die Zahl der Arbeitslosen in der Bundesrepublik auf vier Millionen ansteigen würde. Die Gewerkschaften standen vor der Alternative: der weiter steigenden Massenarbeitslosigkeit tatenlos zusehen oder durch massive Verkürzung der Arbeitszeit, die Arbeit umzuverteilen. Die Gewerkschaften IG Metall und IG Druck und Papier nahmen den Kampf zur Durchsetzung der 35-Stunden-Woche auf.
Anfang Mai 1984 sprachen sich mehr als 80% der IG Metall-Mitglieder in Nordwürttemberg/Nordbaden und Hessen für Streik aus, danach traten in 14 schwäbischen und badischen Automobil-Zuliefererbetrieben 13.000 und eine Woche später in Hessen 33.000 Metaller*innen in den Ausstand. Die Metallarbeitgeber konterten mit der »heißen« Aussperrung, warfen 155.000 Beschäftigte auf die Straße und nutzten außerhalb der Kampfgebiete die »kalte« Aussperrung als politisches und ökonomisches Druckmittel.
Nach sieben Wochen Streik gelang der IG Metall der Durchbruch im Tarifkonflikt: Die Arbeitszeit sank in der westdeutschen Metallindustrie schrittweise zunächst auf 37 Stunden, 1995 dann auf 35 Stunden. Im sogenannten »Leber-Kompromiss« wurde die Arbeitszeitverkürzung an eine flexiblere Verteilung von Arbeitszeiten gekoppelt, d.h. durch den Abschluss von Betriebs-vereinbarungen wurden individuelle Arbeitszeiten zwischen 37 und 40 Stunden pro Woche ermöglicht, sofern eine durchschnittliche betriebliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden eingehalten wurde.
Mit dem Arbeitszeitgesetz, das 1994 in Kraft trat, wurde in § 3 festgeschrieben, dass die tägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer*innen von montags bis freitags »acht Stunden nicht überschreiten« darf. Eine Ausdehnung auf zehn Stunden ist nur dann ausnahmsweise möglich, wenn diese innerhalb von sechs Monaten wieder ausgeglichen wird und damit mittelfristig ein Durchschnitt von acht Stunden erreicht wird. Diese »starre und unflexible« Regelung müsse dereguliert, das Arbeitszeitgesetz »den Realitäten im 21. Jahrhundert« angepasst werden, tönt es erneut aus dem Arbeitgeberlager. »Das deutsche Arbeitszeitgesetz war gut für das Industriezeitalter«, schrieb der Ökonom und »Wirtschaftsweise« Christoph Schmidt bereits im November 2017 in der Süddeutschen Zeitung: »Für die digitale Welt taugt es nicht mehr.«
Dagegen sperren sich die Gewerkschaften. Schließlich ist es ein Hauptziel des Gesetzes, die Sicherheit und Gesundheit der abhängig Beschäftigten zu gewährleisten. Dies ist aufgrund einer fortschreitenden »Entgrenzung der Arbeitszeit« dringender denn je. Denn Berge unbezahlter Überstunden, Arbeit auf Abruf, permanente Arbeitsverdichtung nehmen zu. Laut Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) arbeiten Vollzeitbeschäftigte in Deutschland durchschnittlich 43,4 Stunden in der Woche, bei Teilzeitbeschäftigten sind es real 23,9 Stunden.[5] Als Ursache für Überstunden geben vier von fünf Befragten betriebliche Vorgaben und Gründe an, darunter, dass die Arbeit in der vorgesehenen Zeit nicht zu schaffen sei.
2017 haben die Beschäftigten in Deutschland 2,127 Milliarden Überstunden geleistet – doch nur die Hälfte der zusätzlich geleisteten Stunden sei vergütet worden. Wie die Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag ausweist, hat die Zahl der Überstunden von Voll- und Teilzeitbeschäftigten im Vergleich zu 2016 um rund elf Prozent zugenommen. Durchschnittlich habe jeder abhängig Beschäftigte im Jahr 2017 jeweils knapp 27 bezahlte und unbezahlte Überstunden gemacht. Im ersten Halbjahr 2018 lag die Zahl der Überstunden den Angaben zufolge bei 1,1 Milliarden – ein weiterer Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Dennoch blasen die Arbeitgeberverbände und ihre politischen Vollstrecker zum Generalangriff auf den tariflichen Acht-Stunden-Tag. BDA, BDI und Gesamtmetall fordern: Die Normen der gesetzlichen täglichen Höchstarbeitsdauer sollen durch eine allgemeine maximale Wochenarbeitszeit ersetzt und die Ruhezeit von elf Stunden unterbrochen werden können. Wir müssen »es schaffen, das Leitbild der EU zu übernehmen«, warb Gesamtmetall-Chef Rainer Dulger Ende des vergangenen Jahres in Die Rheinpfalz (21.12.2018).
Die »moderne Arbeitswelt und das Arbeitszeitrecht in vielen Branchen« gerate immer häufiger in Konflikt, begründete die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) ihren aktuellen Vorstoß zur Flexibilisierung des Arbeitszeitrechts. Die wöchentliche Höchstarbeitszeit soll auf 54 Stunden hochgesetzt werden – über einen längeren Zeitraum sollen es aber nicht mehr als 48 Stunden sein, sagte sie gegenüber den Stuttgarter Nachrichten (20.12.2018). Darin ist eine tägliche Höchstarbeitszeit von zwölf Stunden vorgesehen – bislang sind zehn erlaubt. Unterstützung findet sie bei ihrem bayerischen Ministerkollegen Hubert Aiwanger (Freie Wähler), der ebenfalls mehr Flexibilität im Arbeitszeitgesetz fordert, jedoch (vorerst) beschränkt auf das Gastgewerbe, wo sich die »praxisfremden« rechtlichen Vorgaben »mittlerweile zur Wachstumsbremse« entwickelt hätten.
Dieser immer wieder betriebene Versuch eines »Roll-Back« in der Arbeitszeitpolitik[6] steht im krassen Widerspruch zu den tatsächlichen Wünschen der abhängig Beschäftigten nach planbaren Arbeitszeiten, die eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen und bei denen die geleistete Arbeit auch vergütet wird. Deshalb darf die gewerkschaftliche Arbeitszeitpolitik nicht nur darauf ausgerichtet sein, die Angriffe der Arbeitgeber auf den Acht-Stunden-Tag und das Arbeitszeitgesetz abzuwehren, sondern muss die Rückgewinnung der persönlichen und gewerkschaftlichen Deutungs- und Handlungshoheit über die Arbeitszeit im Blick haben. Denn: Wer über die Arbeitszeit bestimmt, bestimmt auch über die Lebenszeit der arbeitenden Menschen. Diese Erkenntnis war die Triebkraft, warum sich die Arbeiter*innen am Ende des 19.Jahrnunderts auf den langen Weg der Arbeitszeitverkürzung machten.
[1] »Der Kapitalist behauptet sein Recht als Käufer, wenn er den Arbeitstag so lang als möglich und womöglich aus einem Arbeitstag zwei zu machen sucht. Andrerseits schließt die spezifische Natur der verkauften Ware eine Schranke ihres Konsums durch den Käufer ein, und der Arbeiter behauptet sein Recht als Verkäufer, wenn er den Arbeitstag auf eine bestimmte Normalgröße beschränken will. Es findet hier also eine Antinomie statt, Recht wieder Recht… Zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt. Und so stellt sich in der Geschichte der kapitalistischen Produktion die Normierung des Arbeitstags als Kampf um die Schranken des Arbeitstags dar – ein Kampf zwischen dem Gesamtkapitalisten, d.h. der Klasse der Kapitalisten, und dem Gesamtarbeiter, oder der Arbeiterklasse.« (Karl Marx: Das Kapital, Kapitel 8: Der Arbeitstag, MEW 23, S. 249)
[2] Die Vorgängerin von Bundesarbeitsminister Heil, Andrea Nahles, hatte in der vergangenen Legislaturperiode der GroKo den Arbeitgebern eine gesetzliche »Öffnungsklausel« in Aussicht gestellt, die Unternehmerverbänden und Gewerkschaften die Möglichkeit geben sollte, per Tarifvertrag von den täglichen Höchstarbeits- und Ruhezeiten abzuweichen.
[3] Bereits da sprach Marx von einem vorausgegangenen langen Kampfzyklus: »Die Festsetzung eines normalen Arbeitstags ist das Resultat eines vielhundertjährigen Kampfes zwischen Kapitalist und Arbeiter«, bei dem es zunächst vom 14. bis Mitte des 18. Jahrhunderts um schrankenlose Nichtregulierung – das »Einsaugungsrecht« des Kapitals – ging, bevor »das moderne Fabrikgesetz den Arbeitstag gewaltsam abkürzt« (ebd., S. 286).
[4] Vgl. Frank Deppe/Otto König: Kein Anlass zum Feiern. 100 Jahre Stinnes-Legien-Abkommen – 100 Jahre »Sozialpartnerschaft«, in: Sozialismus 12/2018.
[5] BAuA: Arbeitszeitbefragung Vergleich 2015-2017. Dortmund/Berlin/Dresden 2018, S. 27ff.
[6] Diese »Roll-Back«-Strategie ist ein internationales Problem: In Österreich hat der Nationalrat auf Betreiben der »schwarz-braunen“ Koalition beschlossen, die gesetzliche Höchstarbeitszeit auf 12 Stunden täglich und 60 Stunden wöchentlich ab 01.September 2018 anzuheben. Vereinbarungen zum 12-Stunden-Tag sollen nur auf betrieblicher Ebene oder mit jedem Arbeitnehmer »freiwillig« einzeln ausgehandelt werden. Im Nachbarland Ungarn hat das Parlament Ende vergangenen Jahres, die seit dem 1. Januar 2019 gültige Novelle des ungarischen Arbeitsrechts beschlossen, diese sieht unter anderem vor, die mögliche Anzahl der jährlichen Überstunden von 250 auf 400 anzuheben. Zudem haben Unternehmer die Möglichkeit, die Mehrarbeit ihrer Beschäftigten nicht innerhalb eines Jahres, sondern binnen dreier zu verrechnet.
König/Detje, Sozialismus, 22.1.19