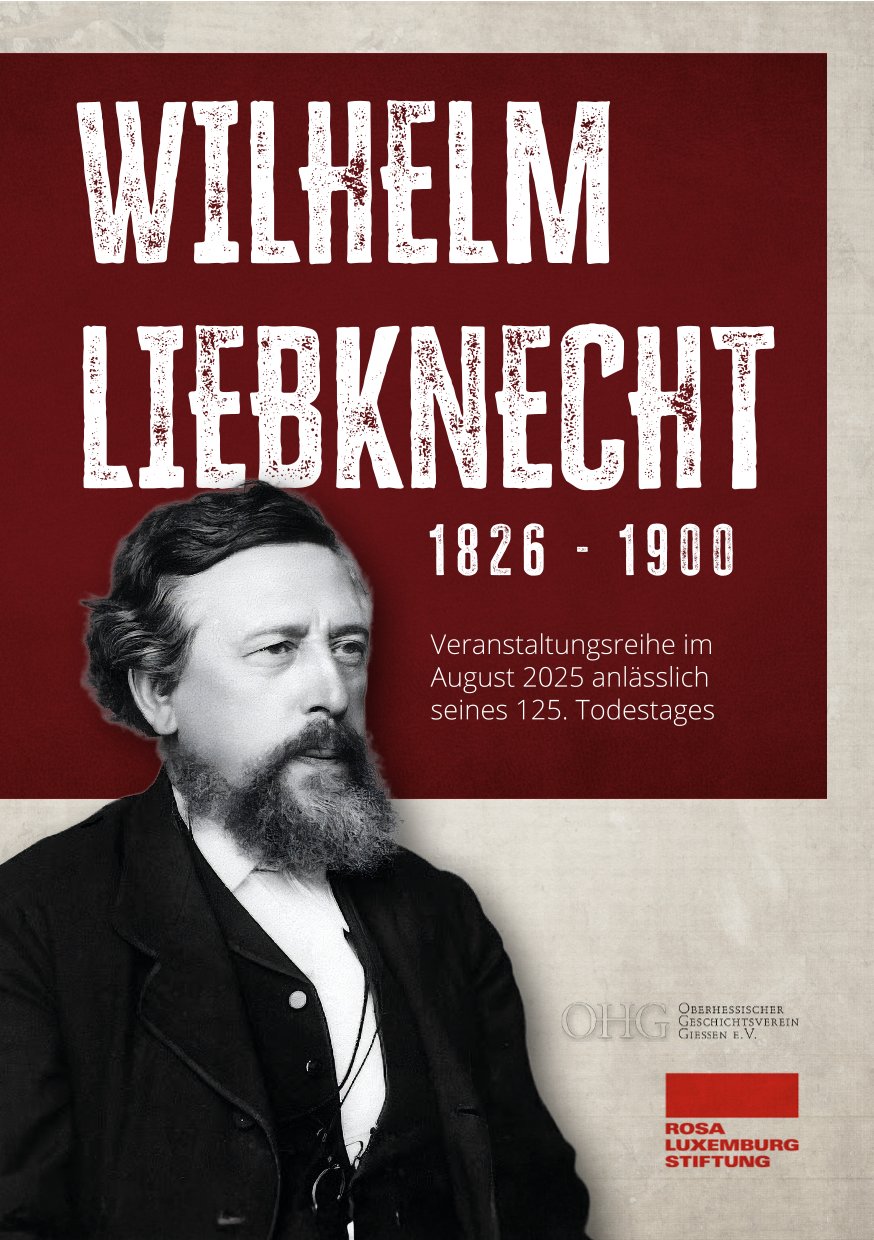Bauen wir Demokratie

Post-Populismus Wer die Rechte nachhaltig schlagen will, muss die Wirtschaft neu aufstellen. Überlegungen für eine soziale und klimagerechte Transformation
Zu den wenigen guten Nachrichten aus dem Seuchenjahr 2020 gehört der knappe Wahlsieg des Demokraten Joe Biden über Donald Trump. Noch ist der Wechsel nicht offiziell vollzogen, doch kann man eines jetzt schon feststellen: Die US-Wahlen entschieden sich nicht zuletzt an der Frage, ob Politik der Wirtschaft oder dem menschlichen Leben der Vorrang geben soll. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben, wie der Humanökologe und Klimaaktivist Andreas Malm schreibt, „das Beste des modernen bürgerliches Staates zum Vorschein“ gebracht – „die Achtung vor dem Leben, die die Achtung vor dem Eigentum übertrumpft“.
Finanzpolitisches Erstaunen
Zunächst wird jede Regierung sich mit Realitäten beschäftigen müssen, die alles andere als einfach sind. Wenn es im Laufe des Jahres hoffentlich gelingt, die Pandemie einzudämmen, werden die wirtschaftlichen Folgen umso stärker spürbar werden. Das gilt auch dann, wenn die Wirtschaft nach dem Ende des Lockdowns wieder deutlich anzieht. Die Schäden, die die globale Rezession verursacht, sind enorm. Eine Zwischenbilanz der Vereinten Nationen zur Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele zeichnet ein verheerendes Bild. Danach sind weltweit bis zu 400 Millionen Arbeitsplätze in Gefahr. 1,6 Milliarden Menschen in der Schattenwirtschaft sind existenziell bedroht. Die klimaschädlichen Emissionen sind zwar so zurückgegangen wie seit Jahrzehnten nicht mehr, haben aber nach dem ersten Lockdown stärker angezogen, als es die Experten erwartet haben. Statt eines Minus von acht rechnen die UN mit einem pandemiebedingten Rückgang 2020 von sechs Prozent. Nötig wären weltweit Reduktionen um 7,6 Prozent – aber nicht als Folge einer Seuche mit anschließender Wirtschaftskrise, die Milliarden in Not und Elend treibt. Wie schon 2009 bewirken Wachstumseinbrüche „degrowth by disaster“.
Auf hohem Reichtumsniveau finden sich diese Tendenzen auch in Deutschland. Für 2021 droht eine Pleitewelle, die vor allem das verarbeitende Gewerbe, den Einzelhandel, Hotels und Gaststätten, den Tourismus und die Kulturwirtschaft betrifft. Schon jetzt verstärkt die Pandemie soziale Ungleichheiten. Nur wer in einem tariflich geschützten Beschäftigungsverhältnis arbeitet, kann damit rechnen, dass das Kurzarbeitergeld über die 60 Prozent vom Einkommen hinaus aufgestockt wird. Während ein erheblicher Teil der Beschäftigten im Homeoffice tätig sein kann, arbeiten die Belegschaften in den Kliniken, Seniorenheimen, Sozialeinrichtungen und Kitas oft bis an die Belastungsgrenze. Leiharbeitskräfte müssen die Lücken stopfen, die Infektionen in die Belegschaften reißen.
All das zeigt, woran es in Europa seit Jahrzehnten mangelt. Es fehlt an Infrastrukturinvestitionen in soziale und ökologische Nachhaltigkeit. 2021 könnte das Jahr sein, in welchem sich das grundlegend ändert, denn fiskal-, finanz- und industriepolitisch hat sich Erstaunliches getan. Insgesamt 1,8 Billionen Euro wollen die Mitgliedstaaten der EU bis 2027 aufwenden, um die Wirtschaft neu aufzubauen. Immerhin 30 Prozent der Gelder sollen für grüne Investitionen, 20 Prozent für die Digitalisierung ausgegeben werden. Zur Finanzierung des Green Deal nehmen die Staaten erstmals gemeinsame Schulden auf. Das ist ein wirtschaftspolitischer Paradigmenwechsel, den manche Verteidiger des nationalen Wohlfahrtsstaates analytisch ausgeschlossen hatten. Für die ökologischen Nachhaltigkeitsziele lässt sich Ähnliches konstatieren. Das europäische Parlament hat die Klimaziele gegen die Voten mächtiger Wirtschaftslobbys deutlich verschärft. Der Staat erlebt als aktiver industriepolitischer Akteur ein Comeback, das die Pandemie überdauern wird. Er interveniert als Ressourcenbeschaffer, Planer und Finanzier von Infrastruktur, Garant von Eigentumsrechten, Seuchen-Manager, und er könnte auch als Beschleuniger sozial-ökologischer Innovation wirken.
Doch hier liegt die Achillesferse des Wiederaufbauprogramms. Jahrzehntelang auf restriktive Haushaltspolitiken und Schuldenreduktion getrimmt, fehlt es den Staatsapparaten an industriepolitischer Fantasie, sie leiden an grassierender Ideenlosigkeit, fehlenden Kontakten zu kleineren Unternehmen, an mangelnder demokratischer Partizipation. Die Programme sind strikt top-down angelegt. Das könnte dazu führen, dass sie, wie schon während der Finanzkrise 2007 bis 2009, letztendlich verpuffen. Um das zu ändern, bedarf es einiger grundlegender Weichenstellungen.
Erstens müssen Gesundheit, Bildung, Mobilität, Energie und Datenzugang wieder zu öffentlichen Gütern werden. Das erfordert massive Investitionen. Soziale Dienstleistungen, zumeist von Frauen erbracht, sind hierzulande unterfinanziert, personell ausgeblutet und gesellschaftlich nicht genügend anerkannt. Schon jetzt klagen Gesundheits- und Sozialwirtschaft über massive Personalengpässe. Die Aufwertung dieser systemrelevanten Tätigkeiten ist eine entscheidende Bedingung dafür, dass sie zu Beschäftigungsalternativen für all jene werden können, die in den Karbonbranchen Kohle-, Stahl- und Autoindustrie ihre Jobs verlieren werden. Ohne eine Stärkung tarifvertraglicher Regelungen wird es in diesen Bereichen keine entscheidenden Fortschritte geben. Besonders wichtig ist, dass Einrichtungen der Sozialwirtschaft aus Leistungssystemen herausgenommen werden, die dazu führen, dass sie an politisch geschaffenen Quasimärkten gegeneinander konkurrieren.
Zweitens müssen Energie- und Verkehrswende rasch und konsequent vorangetrieben werden. Wenn das klimapolitisch notwendige Ziel einer vollständigen Dekarbonisierung der Wirtschaft bis 2050 realisiert werden soll, müssen die Voraussetzungen für nachhaltige Verkehrssysteme geschaffen werden. Letzteres bedeutet weit mehr als eine Umstellung auf E-Mobilität. Es geht darum, unterschiedliche Verkehrsmittel intelligent zu kombinieren. Verkehrs-Apps hätten dafür zu sorgen, dass jedem individuelle Optionen zur Verfügung stünden. Nachhaltige Mobilität bedeutet, die Zentralität des privaten Pkws zurückzudrängen. Weitblickende Branchenvertreter wissen längt, dass mit Motor und Karosse mittelfristig kein Geld zu verdienen sein wird; die Wertschöpfung wird stärker über Elektronik und Sensorik erfolgen. Das Auto hat eine Zukunft, besonders in ländlichen Regionen ist es unentbehrlich. Es muss aber für soziale Bedürfnisse gebaut und in eine Wirtschaft eingepasst werden, die nicht nur für Batterien, sondern auch für Batterie-Recycling sorgt und – etwa mit grünem Wasserstoff für Busse – ständig Innovation für eine Kreislaufwirtschaft produziert.
Eine nachhaltige Industriepolitik muss daher andere Prioritäten setzen als die Aufrechterhaltung deutscher Exportüberschüsse, die systematisch ökonomische Ungleichgewichte produzieren. Staatsinterventionismus verpufft, wenn er nicht Einfluss auf Produktionsentscheidungen nimmt. Dabei wäre der Übergang zu Formen des Kollektiveigentums, das Eigeninitiative nicht erstickt, verhältnismäßig leicht umsetzbar.
So geht Sozialisierung
Von großen Unternehmen wäre zu verlangen, dass sie Staatshilfen mit Verfügungsrechten für Beschäftigte koppeln. Die so entstehende Sozialisierung von Entscheidungsmacht führte zu einem Prozess, der einer Revolution ohne einmaligen Akt der Machtergreifung gleichkäme. Rechtlich ließe sich das mit einer erweiterten Sozialbindung des Eigentums flankieren. Erhielten die Nachhaltigkeitsziele Verfassungsrang, müssten Unternehmen, die sich diesen Zielen verweigerten, mit Sozialisierung, vor allem aber mit der Demokratisierung wirtschaftlicher Entscheidungsmacht rechnen. Auf diese Weise entstünden Institutionen einer transformativen Demokratie. Ihre Einführung ließe bewusst Spielraum für die Erprobung nachkapitalistischer Wirtschaftsweisen. Sie würde eine Abkehr vom BIP als herausragender wirtschaftlicher Steuerungsgröße und deren Ersetzung durch Entwicklungsindikatoren befördern.
Ein Grundproblem der industriepolitischen Top-down-Strategien ist, dass sie auf soziale Umverteilung nahezu vollständig verzichten – wie das aussieht, zeigt das Beispiel Klimagerechtigkeit. Zwar wurden in der EU seit 1990 etwa 25 Prozent der Emissionen eingespart, doch ist das ausschließlich das Verdienst einkommensschwächerer Haushalte. Während die Emissionen des reichsten ein Prozents der Haushalte um fünf Prozent gestiegen sind, haben sie bei den ärmeren 50 Prozent der Haushalte um 34 Prozent abgenommen. Damit ist klar: Eine Nachhaltigkeitspolitik, die ausschließlich auf Marktmechanismen setzt und die Preise für Energie, Mobilität und landwirtschaftliche Produkte erhöht, aber nicht für sozialen Ausgleich sorgt, wird gesellschaftlich Widerstände bei den Inhabern kleiner Portemonnaies erzeugen. Eine Umstellung auf die Produktion langlebiger Güter benötigt daher das Gegenteil ökologischer Austerität. Sie muss Löhne in der unteren Hälfte deutlich anheben, um so den Konsum von nachhaltig hergestellten Produkten zu ermöglichen.
Das führt zu einem letzten Punkt. Nachhaltige Wirtschaftspolitik benötigt Impulse aus der Zivilgesellschaft. Transformationsräte könnten die demokratische Partizipation entscheidend vorantreiben. Über wissenschaftliche Expertinnen hinaus wären sie mit Repräsentanten von ökologischen Bewegungen und Menschenrechtsorganisationen zu besetzen. Sie könnten die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen überwachen, die Produktion langlebiger Güter einfordern und so Regierung und Parteien immer wieder mit dem ökologisch und sozial Nötigen konfrontieren.
Die Liste von Projekten, die für eine Nachhaltigkeitsrevolution unentbehrlich sind, ließe sich erheblich erweitern. Entscheidend ist bei all dem jedoch die Richtung, die eingeschlagen wird. Es geht um Investitionen in das Fundament einer – nunmehr transformativen – Demokratie und damit um die beste Rückversicherung gegen einen erneuten Aufschwung der radikalen Rechten.