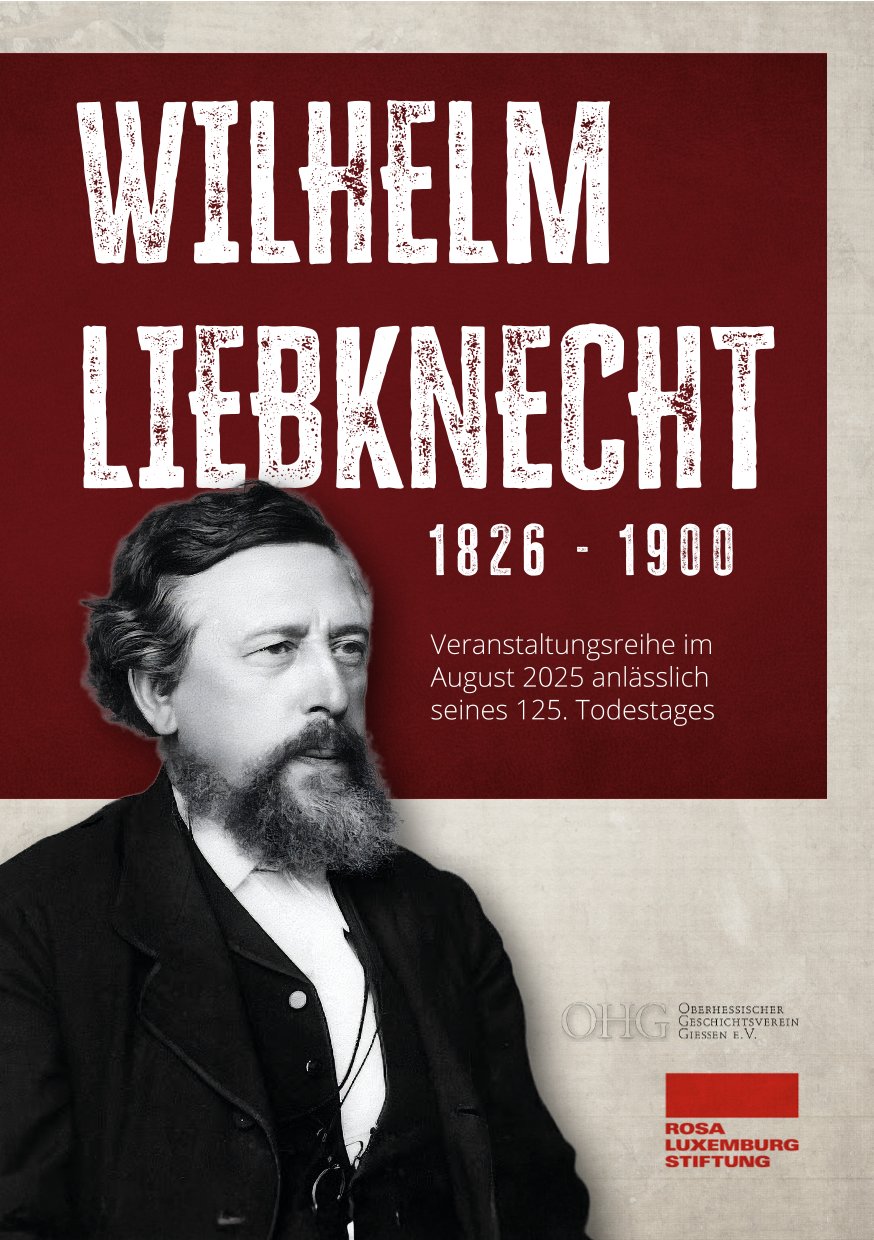Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Harz IV-Sanktionssystem: »Im Prinzip ja, aber …«

Am 5. November hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) über das Hartz IV-Sanktionssystem entschieden.[1] Heraus kam ein kräftiges »Im Prinzip ja, aber …« Das Gericht folgte also wieder einmal dem berühmten Radio Eriwan-Grundsatz.
Man kann es auch positiver ausdrücken: Anders als in der Politik ist eine Kompromissfindung zwischen unterschiedlichen politischen Positionen beim BVerfG noch möglich, was natürlich auch daran liegt, dass das Gericht nach dem alten Parteiproporz zusammengesetzt ist, die Richter*innen also zwischen den (ehemaligen) Volksparteien aufgeteilt werden. Das Gericht musste begründen, warum denn eine Kürzung des sozio-kulturellen Existenzminimums verfassungsrechtlich erlaubt ist, wenn dieses Minimum doch vom Grundgesetz garantiert ist.
Um das Resümee vorwegzunehmen: Dieser Aufgabe ist das Gericht nicht gerecht geworden. Trotzdem hat das Urteil auch erfreuliche Seiten, stärkt es doch weiter den Sozialstaat.
Das sozio-kulturelle Existenzminimum hat das BVerfG im ersten Hartz IV-Urteil vom 9.2.2009 als grundrechtlich garantiertes Minimum anerkannt. Aus der Menschenwürde (Art. I Abs. 1 GG) und dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) schloss das Gericht auf ein Grundrecht auf ein sozio-kulturelle Existenzminimum, das jeder Mensch in einer Notlage vom Staat einfordern könne, d.h. was der Staat wegen der genannten verfassungsrechtlichen Grundlagen zum Unterhalt jedes Menschen in der Bundesrepublik zahlen müsse.
Im neuen Urteil bezieht sich das Gericht auf dieses ältere Urteil und wiederholt den Anspruch auf das sozio-kulturelle Existenzminimum. Soziokulturell nennt das BVerfG dieses Minimum, weil es eben nicht nur das nötigste zum Überleben umfasst ‒ gleichsam die Schüssel Reis täglich ‒, sondern das Minimum, das erforderlich ist, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, also auf dem materiellen Niveau der bundesrepublikanischen Gesellschaft mitzuschwimmen, nicht ausgestoßen zu sein, oder um nicht direkt als arm aufzufallen.
Armut kann wohl existieren, aber der Bürger will sie nicht sehen. Auch wenn das spöttisch klingt, das BVerfG argumentiert hier demokratiefreundlich. Politische Teilhabe setzt ein bestimmtes Lebensniveau voraus. Teilhabe auch der ärmeren Menschen ist für eine Demokratie, die diesen Namen verdient hat, aber unabdingbar. Deshalb muss das Existenzminimum mehr umfassen als das unbedingt Lebensnotwendige.
Das BVerfG formuliert das so: »Der verfassungsrechtlich garantierte Leistungsanspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums erstreckt sich auf die unbedingt erforderlichen Mittel als einheitliche Gewährleistung zur Sicherung sowohl der physischen Existenz als auch zur Sicherung eines Mindestmaßes an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Die Verankerung des Gewährleistungsrechts im Grundrecht des Art. 1 Abs. 1 GG bedeutet, dass Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung (Art. 1 Abs. 3 GG) den Menschen nicht auf das schiere physische Überleben reduzieren dürfen, sondern mit der Würde mehr als die bloße Existenz und damit auch die soziale Teilhabe als Mitglied der Gesellschaft gewährleistet wird.« (Rnr. 119)
Das Hartz IV-System, genauer §§ 31 ff SGB II, sehen aber Sanktionen vor, wenn die/der Hartz IV-Empfänger*in bestimmte Auflagen des Jobcenters nicht befolgt, sich nicht regelmäßig meldet oder bei einem Unternehmen bewirbt. Diese Sanktionen bestehen aus einer Kürzung der Hartz IV-Bezüge, gestaffelt zwischen 30% und einer Vollkürzung. Wenn nun aber mit Hartz IV das Existenzminimum gezahlt wird, sinkt man mit Kürzungen unter das Existenzminimum. Dieses aber ist durch die Menschenwürde und den Sozialstaat garantiert. Man braucht also einen guten Grund, um zu rechtfertigen, dass das Existenzminimum gekürzt werden kann.
Dabei bemerkt das Gericht mehrfach, dass eine solche Kürzung nicht damit zu rechtfertigen sei, dass doch der sozio-kulturelle Teil gekürzt werden könne, das nackte Überleben wäre doch immer noch garantiert. Das Gericht führt aus: »Der Gesetzgeber kann auch weder für einen internen Ausgleich noch zur Rechtfertigung einer Leistungsminderung auf die Summen verweisen, die in der pauschalen Berechnung der Grundsicherungsleistungen für die soziokulturellen Bedarfe veranschlagt werden, denn die physische und soziokulturelle Existenz werden durch Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG einheitlich geschützt.« (Rnr. 119)
Wie also kann die Kürzung des einheitlichen Existenzminimums gerechtfertigt werden? Das Gericht macht einen Umweg und erklärt zunächst, dass der Gesetzgeber von der/dem Hartzer*in Mitwirkung verlangen könne. Die Leistung werde nur gewährt, um eine Notsituation abzuwenden und die/der Empfänger*in müsse alles tun, damit diese Notsituation nicht entsteht oder möglichst bald beendet wird. In der Formulierung des Gerichts: »Das Grundgesetz steht auch einer Entscheidung des Gesetzgebers nicht entgegen, von denjenigen, die staatliche Leistungen der sozialen Sicherung in Anspruch nehmen, zu verlangen, an der Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit selbst aktiv mitzuwirken oder die Bedürftigkeit gar nicht erst eintreten zu lassen.« (Rnr. 126)
Solche Mitwirkungspflichten sind aber, so das Gericht, immer mit einem Eingriff in Grundrechte verbunden ‒ im Zweifel in die allgemeine Handlungsfreiheit ‒ und bedürfen deshalb der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung meint immer: Sie müssen verhältnismäßig sein.
Der Gesetzgeber dürfe Mitwirkungspflichten normieren und dürfe diese auch sanktionieren, meint das Gericht. Diese Sanktion könne in einer verhältnismäßigen Leistungskürzung bestehen. Anders gesagt: Die Frage wurde verschoben und lautet nun: Wann sind sanktionierte Mitwirkungspflichten verhältnismäßig? Sie lautet nicht mehr: Verstößt es gegen die Menschenwürde, das Existenzminimum zu kürzen? Das Gericht hat diesen argumentativen Trick durchaus selbst bemerkt, und greift die alte Frage nochmal auf ‒ man merkt gleichsam das schlechte Gewissen. Aber sie wird nicht beantwortet, sondern nur noch einmal behauptet: Verhältnismäßige Mitwirkungspflichten dürfen auch mit verhältnismäßigen Sanktionen geahndet werden.
Die Stelle im Urteil lässt die Vermeidungsstrategie deutlich erkennen: »Das Grundgesetz steht der Entscheidung nicht entgegen, nicht nur positive Anreize zu setzen oder reine Obliegenheiten zu normieren. Der Gesetzgeber kann für den Fall, dass Menschen eine ihnen klar bekannte und zumutbare Mitwirkungspflicht ohne wichtigen Grund nicht erfüllen, auch belastende Sanktionen vorsehen, um so ihre Mitwirkung an der Überwindung der eigenen Hilfebedürftigkeit durchzusetzen; er berücksichtigt ihre Eigenverantwortung, indem die Betroffenen die ihnen bekannten Folgen zu tragen haben, die das Gesetz an ihr Handeln knüpft. Wird die Verletzung einer Mitwirkungspflicht durch eine Minderung existenzsichernder Leistungen sanktioniert, fehlen der bedürftigen Person allerdings Mittel, die sie benötigt, um die Bedarfe zu decken, die ihr eine menschenwürdige Existenz ermöglichen. Mit der verfassungsrechtlichen Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz kann eine Leistungsminderung dennoch vereinbar sein. Sie kann die Anforderungen aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG wahren, wenn sie nicht darauf ausgerichtet ist, repressiv Fehlverhalten zu ahnden, sondern darauf, dass Mitwirkungspflichten erfüllt werden, die gerade dazu dienen, die existenzielle Bedürftigkeit zu vermeiden oder zu überwinden. (Und das ist dann der Zirkelschluss! A.F.) Dann dient die Leistungsminderung wie auch die Pflicht, die mit ihr durchgesetzt werden soll, dazu, den existenznotwendigen Bedarf auf längere Sicht nicht mehr durch staatliche Leistung, sondern durch die Eigenleistung der Betroffenen zu decken. Der Gesetzgeber kann insofern staatliche Leistungen zur Sicherung der Existenz auch mit der Forderung von und Befähigung zu eigener Existenzsicherung verbinden.« (Rnr. 130 f)
Die Einschränkung oder die teilweise Verfassungswidrigkeit der bestehenden Regelung folgt aus den Verhältnismäßigkeitserwägungen. In Ordnung sei eine Kürzung um 30%, allerdings nur wenn es Härtefallregelungen im Einzelfall gäbe und wenn die starre Frist von drei Monaten flexibler werde. Die/Der Hartzer*in soll also durch Wohlverhalten den Sanktionszeitraum abkürzen können.
Unverhältnismäßig seien auch die Kürzungen um 60% oder gar die volle Leistungskürzungen, wobei auch hier die starren Sanktionszeiträume nicht mit der Verfassung vereinbar seien.
In der Sprache des Gerichts heißt das: »Die in § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II normierte Höhe einer Minderung um 30% vom maßgebenden Regelbedarf ist für sich genommen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu beanstanden. Doch genügen den hier strengen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit die nach § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II in der derzeitigen Ausgestaltung zwingende Vorgabe, auch in Fällen außergewöhnlicher Härte existenzsichernde Leistungen zu mindern, und die nach § 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II unabhängig von der Mitwirkung der Betroffenen starr vorgegebene Dauer nicht. Mit § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II kann sich der Gesetzgeber zudem grundsätzlich dafür entscheiden, im Fall wiederholter Pflichtverletzung erneut zu sanktionieren. Eine Minderung in dieser Höhe ist jedoch nach derzeitigem Erkenntnisstand jedenfalls nicht zumutbar. Das gilt auch hier für die zwingende und starr andauernde Ausgestaltung. Ebenso wenig ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand der völlige Wegfall des Arbeitslosengeldes II nach § 31a Abs. 1 Satz 3 SGB II verfassungsrechtlich zu rechtfertigen.« (Rnr. 137)
Erfreulich an diesem Urteil ist, dass das Gericht erstens die Situation von Hartz IV-Empfänger*innen verbessert hat. Erfreulich ist auch, dass das Grundrecht auf ein einheitliches sozio-kulturelles Existenzminimum bestätigt und ausdifferenziert wurde. Erfreulich ist auch, dass das BVerfG signalisiert, dass es die Ausformung des Sozialstaates weiter gerichtlich kontrollieren will.
Wenig überzeugend ist die Argumentationsstrategie, um die Kürzung dieses Minimums zu rechtfertigen.
Andreas Fisahn ist Professor für öffentliches Recht und Rechtstheorie an der Universität Bielefeld und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat von Attac. Zuletzt hat er gemeinsam mit Ridvan Ciftci im VSA: Verlag den Band Nach-Gelesen. Ein- und weiterführende Texte zur materialistischen Theorie von Staat, Demokratie und Recht herausgegeben.
Anmerkung
[1] BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 5. November 2019 – 1 BvL 7/16 –. Randnummernverweise beziehen sich auf dieses Urteil.
Andreas Frisahn, sozialismus, 7.11.19