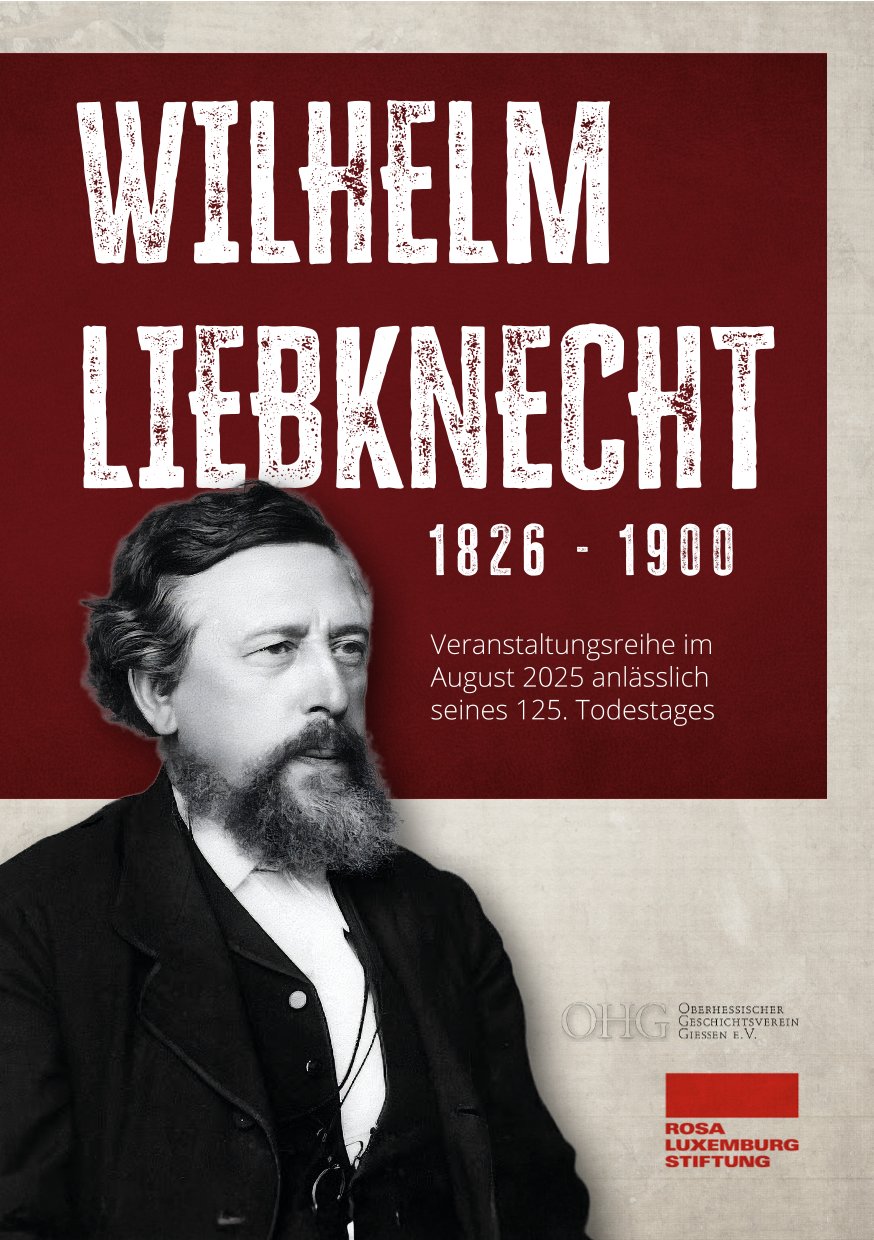»Das Verrückte an Podemos war, dass es von der Bevölkerung sofort überrannt wurde«

Miguel Urbán über massenhafte Selbstorganisation in der Mediendemokratie, die Debatten in der spanischen Linken und die SYRIZA-geführte Regierung in Griechenland
Urbán gehört nach wie vor zu den wichtigsten Protagonisten der linken Bürgerbewegung. Seit einigen Monaten ist er Abgeordneter des Europaparlaments und eine zentrale Figur bei Podemos in Madrid. Mit ihm sprach Raul Zelik.
Die Gründung von Podemos im Sommer 2013 wird oft damit erklärt, dass an der Universidad Complutense ein Kreis von Politikwissenschaftlern zusammengekommen sei. Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Luis Alegre und Carolina Bescansa, die in den 2000er Jahren viel in Lateinamerika waren, hätten die Frage formuliert, wie man den Neoliberalen die Kontrolle der Institutionen streitig machen kann. Sie sind Mitgründer von Podemos, gehören aber nicht zu diesem Kreis. Müssen wir die Podemos-Geschichte neu schreiben?
Juan Carlos Monedero kam erst vier Monate später zu der Initiative. Aber es ist auch nicht wichtig, wer als erstes die Idee hatte. Das Entscheidende ist, dass Podemos nicht ohne die 15M-Bewegung, ohne die Mareas, also die Proteste zur Verteidigung des Gesundheits- und Bildungswesens, existieren würde. Das muss man immer wieder betonen: Das Regime hatte eine schwere politische Niederlage erlitten, bevor Podemos entstand. Die Platzbesetzungen im Mai 2011 brachen den herrschenden Konsens auf und schufen eine Gegenhegemonie gegen die Austeritätspolitik.
Ich denke, dass die Gründungsgruppe von Podemos, zu der Pablo Iglesias und auch ich gehörten, das richtig interpretiert haben. Das war allerdings nicht unser erster Versuch, »ins Schwarze zu treffen«. Einige von uns kommen ja aus der »Antikapitalistischen Linken«, und dort versuchten wir ja schon lange, eine breite, offene, partizipative politische Bewegung aufzubauen. Wir haben es jahrelang versucht und offensichtlich immer etwas falsch gemacht – denn wir wurden nicht mehr.
Im August 2013 haben wir dann auf der Sommeruniversität der Izquierda Anticapitalista über eine Initiative wie Podemos gesprochen – unter anderem mit Pablo Iglesias. Den Namen haben wir erst vier Monate später gewählt. Ich bin also nicht einverstanden mit der Darstellung, dass Podemos in einem Labor von Politikwissenschaftlern entwickelt wurde. Es stimmt natürlich, dass der Kreis dort wichtige Debatten geführt hat. Aber weder die »Antikapitalistische Linke« noch der Kreis an der Uni bringt Podemos hervor, sondern vier Jahre Widerstand auf den Straßen und Plätzen.
Könnte man sagen, dass es drei tragende Säulen gab: den Debattenkreis an der Uni, die »Antikapitalistische Linke« als Organisation und der alternative Fernsehsender La Tuerka?
Ich hatte das Glück, sehr nah an allen drei Prozessen zu sein: Ich war und bin Sprecher von Anticapitalistas, war mit anderen an dem Medienprojekt La Tuerka beteiligt und habe die Debatten der Unigruppe um Pablo mitverfolgt. Wir haben festgestellt, dass wir die Situation ähnlich einschätzen.
Das Verrückte an Podemos war, dass es von der Bevölkerung sofort überrannt wurde – die Leute haben sich das Projekt angeeignet. Und das ist die Grundlage des Widerspruchs heute: Auf der einen Seite gibt es diese überschäumende, massenhafte Selbstorganisation und auf der anderen ist da der Medienapparat. Das ist eine notwendige, aber sehr komplizierte Verbindung. Wenn Podemos sich in die eine oder andere Richtung entwickelt – nur Selbstorganisation oder nur Medienapparat wird -, geht die Kraft verloren.
Oft wird die Frage gestellt, warum Sie sich eigentlich nicht der bestehenden, durchaus pluralen »Vereinigten Linken« angeschlossen haben? Die Izquierda Unida ist ihrem Anspruch nach doch auch eine Unidad Popular – ein breites, populares Bündnis.
Zwischen Theorie und Praxis gibt es leider oft einen Graben. Wir haben IU am Anfang einen Vorschlag unterbreitet: IU sollte ihre Fraktionskämpfe beenden, sich nicht so viel mit Partei und Posten beschäftigen. Aber das hat IU nicht geschafft.
Es ist nicht so, dass wir keine Erfahrung mit dieser Partei gesammelt hätten. Pablo Iglesias, ich und viele andere waren einmal bei IU. Das waren unangenehme Erfahrungen: wenig Beteiligung, viel Bürokratie, alles sehr kleinkariert, auf die Institutionen fixiert. Man hatte große Angst davor, etwas auszuprobieren, Fragen zu formulieren, zu forschen. Das Innenleben der Partei war immer wichtiger als die gesellschaftliche Situation.
Wir müssen aber auch zugeben, dass Podemos während des Organisierungsprozesses etwas Ähnliches passiert ist. Ich denke, das ist eine große Gefahr für jede politische Organisation.
Ist Izquierda Unida eine Partei des Regimes?
Ja und nein. Die Transition, also der Öffnungs- und Modernisierungspakt zwischen Frankisten und Demokraten 1975 bis 1979, wäre ohne die Kommunistische Partei nicht möglich gewesen. Das hatte positive, aber vor allem negative Folgen, und Izquierda Unida, die ja stark von der KP beeinflusst wird, trägt dieses Gen einer staatstragenden Partei immer noch in sich. Die jüngeren IU-Leute, die aus sozialen Bewegungen kommen und am 15M beteiligt waren, sind supernett, superkorrekt. Deswegen muss die Antwort widersprüchlich ausfallen.
Aber fest steht, dass wir die spanische Verfassung mit ihren ganzen undemokratischen Elementen auch der KP verdanken. Sie plädierte damals für einen Pakt anstatt für einen Bruch mit dem Frankismus.
Wie groß ist die Gefahr, dass sich in einer Bürgerbewegung wie Podemos apolitische oder rechte Positionen durchsetzen? Pablo Echenique, der Spitzenkandidat in Aragón, hat es in einem – sehr sympathischen – Text ja neulich selbst gesagt: »Ich war bis vor kurzem Liberaler.«
Das ist das Schöne an diesem Prozess. Die Leute entdecken sich als politische Subjekte und fangen an, kritische Fragen zu stellen. Meiner Ansicht nach ist eine Revolution nichts anderes als das Hineindrängen der Massen in die Politik. In dieser Hinsicht war die 15M-Bewegung eine Revolution. Und auch Podemos zeichnet sich dadurch aus, dass unpolitische Menschen anfangen, Politik zu machen. Es ist einfach so: Im Aktivismus lernt man in einem Monat mehr als in 100 Jahren in einer klassischen Partei. Der 15M war viel wichtiger als alle linken Organisationen.
Echenique ist ein wunderbares Beispiel dafür. Er ist Physiker, vor zehn Jahren hat er noch den Irak-Krieg befürwortet und die rechte Ciudadanos-Partei gewählt. Jetzt sagt er von sich: »Ich fühle mich jeden Tag ein bisschen marxistischer.« In der Auseinandersetzung mit Widersprüchen verändern wir uns. Im Übrigen ist das unsere einzige Hoffnung. Wenn wir uns nicht ändern könnten, wären wir verloren.
Wahlparteien wollen repräsentieren und führen. Das steht im Widerspruch zum »Hineindrängen der Massen in die Politik«.
In einem Interview mit der »El País« hat eine Journalistin vor ein paar Monaten gesagt, wir wären wie die Armee von Pancho Villa und würden versuchen, zu einer regulären Armee zu werden. Ínigo Errejón, der politische Sekretär von Podemos, sagt ja selbst gern solche Sätze: »Wir brauchen einen Kampagnenapparat, um die Wahlschlacht zu gewinnen.« Ich halte das für falsch. Wir müssen wie die Armee Pancho Villas bleiben. Wenn wir mit den anderen Parteien auf ihrem Terrain zu konkurrieren beginnen, werden wir scheitern. Unsere Waffen müssen andere sein: Selbstorganisation, Eigeninitiative, die Unkontrollierbarkeit der Massen, der Enthusiasmus der vielen. Ja, wir brauchen auch systematische Kommunikation. Aber wenn wir klassische Hierarchien aufbauen, um zu gewinnen, werden wir nicht gewinnen. Das ist mein Hauptwiderspruch zu manchen Leuten in der Podemos-Führung. Wir können Veränderungen nicht aufschieben, bis wir irgendwann einmal gewonnen haben. Wir müssen uns jetzt ändern, um gewinnen zu können.
Und so müssen wir auch in den Parlamenten auftreten: nicht das machen, was alle tun, sondern die Regeln brechen: Transparente aufhängen, Leuten ein Forum bieten, die sonst nicht gehört werden, nach Griechenland fahren und sich mit Projekten solidarisieren, Allianzen schmieden.
Bei den Gemeinderatswahlen im Mai haben die von kommunalen Basisgruppen initiierten (und von Podemos unterstützten) Bündnisse in den Großstädten oft besser abgeschnitten als die Podemos-Kandidaturen. Braucht ein radikal-demokratisches Projekt vielleicht einen Grad von Unbestimmtheit, um offen zu bleiben?
Die Wahlergebnisse sind nicht so eindeutig. Eigentlich nur in Madrid, wo die Liste AhoraMadrid unter Manuela Carmena 12 oder 14 Prozent mehr Stimmen bekommen hat als Podemos bei den gleichzeitig stattfindenden Autonomiewahlen. Aber das hatte auch viel mit der Wahlkampagne und den Leihstimmen von PSOE-Anhängern zu tun, die in erster Linie die PP abwählen wollten.
Eine offene Kandidatur wäre für die gesamtspanischen Wahlen im Herbst sich sehr gut. Damit meine ich keine Koalition von linken Parteien, sondern eher eine gemeinsame, offene Kandidatur – und das auch gar nicht so sehr, um die Wahlen zu gewinnen, sondern um für die Konflikte nach den Wahlen besser gewappnet zu sein. Man muss allerdings auch daran erinnern, dass Podemos eigentlich als eine offene Plattform gegründet wurde.
Wahrscheinlich wird so eine Kandidatur in den Regionen einfach unterschiedliche Namen haben. In Katalonien würde sie eher CatalunyaEnComú heißen, in Madrid eher Podemos.
Manuela Carmena hat in Madrid über 30 Prozent bekommen und ist jetzt Bürgermeisterin. Warum war diese Liste so erfolgreich?
Es war ein Wahlkampf von unten, der alle Regeln und Dämme durchbrochen hat. Es gab zwar ein Kampagnenbüro, das eine Wahlkampfstrategie entwickelt hatte. Aber die Leute haben sich darüber hinweggesetzt und eigene Ideen entwickelt. Sie haben eigene Veranstaltungen gemacht, eigene Clips gedreht: Fast täglich haben Künstlerinnen Statements für AhoraMadrid ins Netz gestellt. Die zentrale Strategie war also wichtig, aber noch wichtiger war die Selbstorganisation, das Guerillaartige des Wahlkampfs.
In der Führung Ihrer Partei ist viel von der »Marke Podemos« und vom »politischen Marketing« die Rede … Wie weit darf man sich auf die Gesetze des massenmedial und marktförmig entfremdeten Politikbetriebs einlassen?
Jeder findet es schön, wenn das, was er als Beruf erlernt hat, für etwas gut ist. Das war bei der 15M-Bewegung so, wo viele Leute Arbeitsgruppen zu ihren Studienschwerpunkten gebildet haben, und heute ist es bei Podemos auch oft so, dass die Perspektive der Politikwissenschaftler ein bisschen zu viel Gewicht erlangt.
Meiner Ansicht nach kann man Politik aber nicht auf der Marketing oder der Analyse von Meinungsumfragen begründen. Ich glaube auch nicht, dass Podemos das macht. Es gibt bei uns viele Gravitationszentren und viel Kommunikation. Ja, es gibt Leute, die mit ihrer Wahlkampfmaschine »einen Krieg gewinnen« wollen. Aber insgesamt ist doch klar, dass politische Kommunikation zwar wichtig, aber nicht das Allerwichtigste ist. Wir haben schon am Anfang darüber geredet – man darf nicht in die Dichotomie ‚Kommunikationsapparat versus Selbstorganisation‘ verfallen. Wir brauchen beides.
Podemos will an die Regierung. Wenn man nach Griechenland schaut, stellt man sich jedoch die Frage, ob das nicht auch als bloße Oppositionsform gedacht werden muss. Gegenüber den faktischen Mächten des neoliberalen Europas hat die Syriza-Regierung wenig zu melden …
Ich war vor kurzem bei der griechischen Vizeministerin für Migration. Wie sie dort gegen den institutionellen Rassismus vorgehen, Abschiebezentren schließen, mit Flüchtlingen umgehen – das ist schon sehr anders als früher … Wow, habe ich gedacht, und das obwohl Syriza die ganze EU gegen sich hat.
Als Athen angekündigt hat, die Abschiebezentren zu schließen, hat die EU die Rückzahlung der Subventionen für den Bau dieser Zentren gefordert. So weit reicht der EU-Boykott.
Ich glaube schon, dass es etwas bringt, die Regierung zu stellen. Aber dafür benötigt man ein anderes Kräfteverhältnis in der Gesellschaft – die Selbstorganisation der Menschen. Denn du musst gleichzeitig Regierung und Opposition sein. Du musst die Bevölkerung als Opposition mobilisieren, um Druck zu schaffen, und gleichzeitig die Regierung als ein Instrument verstehen, um die Armut zu verwalten – denn diese Aufgabe erwartet eine Linksregierung: Die Rechte und die EU zwingen das Land ins Elend. Um das durchzustehen, braucht man viel mutige Bevölkerung.
Aber es stimmt: Wenn man sich als Linke in der EU behaupten will, muss man bereit sein, einseitig sehr harte Maßnahmen zu ergreifen. Ansonsten wird man über nichts verhandeln können. Möglicherweise steht Griechenland heute vor diesem Schritt.
Eine Linksregierung in Spanien würde vor dem Problem stehen, dass das ökonomische Modell erledigt. Mit dem EG-Beitritt 1986 wurde das Land systematisch deindustrialisiert. Die Strukturförderung hat sich seitdem auf den Bau- und Tourismussektor beschränkt: Die Immobilienblase ist geplatzt, in Barcelona wollen die Menschen von der »Monokultur Tourismus« weg. Wie soll das funktionieren?
Wir brauchen ein anderes, produktiveres Modell. Dabei geht es nicht um den Wiederaufbau des industriellen Geflecht – eine Romantisierung der fordistischen Vergangenheit ist wirklich fehl am Platz. Wir brauchen eine sozialökologische Transformation. Ein anderes Produktionsmodell, Energiewende, die Förderung von Genossenschaften. Wo könnte man anfangen? Ich denke, der Energiesektor könnte ein Ansatzpunkt für einen ökonomischen Umbau sein. Das ist ein beschäftigungsintensiver Bereich, in dem hochqualifizierte Arbeit nötig ist und viel Mehrwert erwirtschaftet wird.
Um Entwicklung gestalten zu können, brauchen wir mehr Wirtschaftsdemokratie ausbauen. Banken in öffentlicher Hand, die von der Bevölkerung kontrolliert werden. Eine Umverteilung des Agrarlands, denn im spanischen Staat spielt Großgrundbesitz immer noch eine zentrale Rolle.
Das sind große Herausforderungen, aber wenn wir sie nicht angehen, werden wir keinen Erfolg haben.
Das alles wird nur gegen die EU gehen.
Wir sind zutiefst pro-europäisch. Europa ist Teil des Problems, aber auch die Lösung. Wir brauchen ein Europa, wie es die Partisanen der 1940er Jahren vor Augen hatten: ein antifaschistisches, linkes Europa der Menschen und Völker. Das wird nur gehen, wenn wir die neoliberalen Fundamente der EU zerschlagen, und dafür wiederum müssen wir die Kräfteverhältnisse in den einzelnen Ländern ändern. Ich bin überzeugt, dass so eine Veränderung nur aus dem europäischen Süden kommen kann, wozu ich auch Irland zählen würde, weil es kein geographischer, sondern ein politischer Raum ist.
nd, 19.06.15