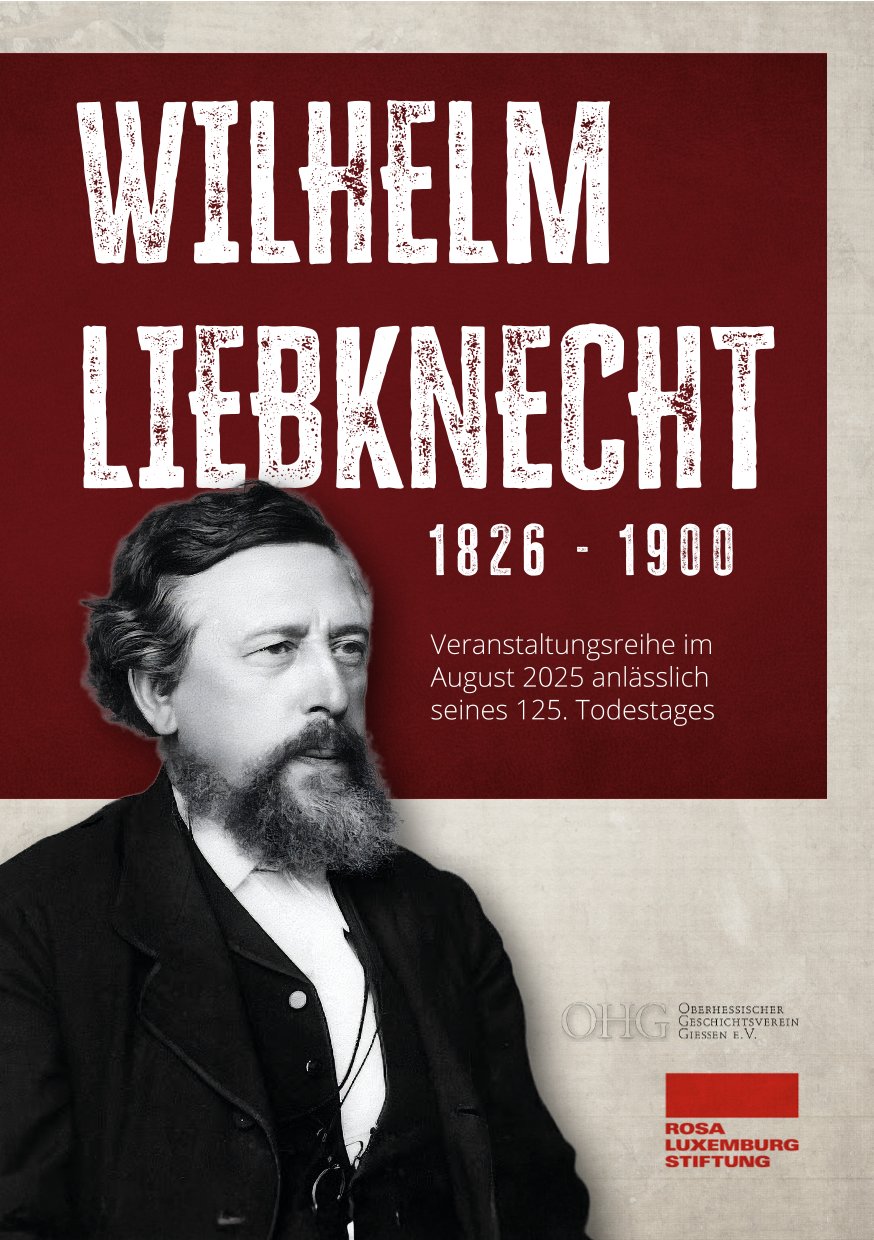Am Montag ist ein großer Literat verstorben. Ein wortgewaltiger Mann. Seine Themen waren der Kolonialismus und sein Kontinent. Und die Einsicht, dass der Reichtum Südamerikas die Armut beflügelt. Er war nicht ganz so berühmt wie der, der am selben Tag wie er starb. Schade eigentlich.

Eduardo Galeano
Foto: dpa/Alejandro Ernesto
Der am Montag verstorbene Günter Grass habe die Bundesrepublik geprägt, las man in den Nachrufen. Stimmt wohl. Der Mann war tatsächlich der Chronist von Krieg, Wiederaufbau und Wiedervereinigung. Ein Kollege von Grass dürfte seiner Heimat aber weitaus mehr seinen Stempel aufgedrückt haben. Und wie es ein trauriger Zufall wollte, starb der Mann am selben Tag wie sein deutscher Kollege. Sein Name: Eduardo Galeano – Autor von »Die offenen Adern Lateinamerikas«, einem monumentalem Werk, das die Kolonialgeschichte seines Kontinents zum Gegenstand hatte. Seine paradox klingende Theorie bringt die ganze Misere von Schwellen- und Entwicklungsländern in der modernen Welt auf den Punkt.Der linke Essayist und Kritiker erklärte nämlich, dass der Reichtum unter den Füßen der Lateinamerikaner liege. An Ressourcen mangele es ja nicht. Dennoch haben die Menschen nichts von diesen Gütern. Erst war es der klassische Kolonialismus, der diese Reichtümer abzog und die eigentlichen Besitzer dieses Reichtums nicht entschädigte. Später erledigte das dann die moderne Variante, die man Freihandel nennt und die internationalen Konzernen freie Hand lässt. Diese bittere Erkenntnis bringt auf den Punkt, wieso der Kampf gegen die Armut zum Scheitern verurteilt ist. Der Yankee-Kapitalismus des Westens untergräbt ihn, indem er den natürlichen Reichtum in strukturelle Armut verwandelt.Galeano hat Männer beeinflusst, die man heute als die Gesichter des südamerikanischen Linksrucks ansieht: Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa oder Lula. Sie alle haben sich bemüht, die US-amerikanische Hegemonie auf ihre Länder zu schmälern. Einige führen diesen Kampf noch immer. Chávez hat diesen Vorgang »Bolivarische Revolution« oder kurz »Bolivarismus« genannt. Er bezieht sich hierbei auf Simón Bolívar, der den Kampf gegen die spanische Kolonialmacht anführte und den Lateinamerikanern ein neues politisches und geschichtliches Bewusstsein als sein Erbe hinterließ. Der Bolivarismus versteht sich als Gegengewicht zum Neoliberalismus, der in den Sechzigern, Siebzigern und Achtzigern den Kontinent (gepaart mit Militär- und/oder Marionettenregimes) im Griff hatte. Endlich sollten die Südamerikaner aufstehen und sich gegen die Einflüsse neoliberaler Hinterhofpolitik zur Wehr setzen. Sie sollten Regierungen erhalten, die das Wohl der Bevölkerung im Auge haben und die den natürlichen Reichtum nicht verschleudern, sondern zu Wohlstand verwandeln. Ein neues, ein auf die Herkunft bezogenes Selbstbewusstsein sei nötig.
Das jedenfalls ist der Ansatz des Bolivarismus. Chávez sagte mehrfach, dass Galeanos »offene Adern« ihn beeinflusst hätten. 2009 hat er Barack Obama auf dem Amerika-Gipfel vor laufender Kamera ein Exemplar des Buches überreicht. Das hatte Symbolcharakter. Auch für den Stellenwert, den Chávez Galeano beimaß. Denn dass es so nicht weitergehen konnte, war den eher linken Politikern Südamerikas klar. Sie kannten ihren Galeano, der den Lateinamerikanern ein neues Bewusstsein anriet. Ressourcen mussten endlich Bildungs- und Gesundheitsprogramme zur Folge haben. Und es mussten erste soziale Standards geschaffen werden. Venezuela ist reich an Erdöl und war vor Chávez ein Land voller Armut. Heute grassiert dort nicht der Reichtum. Aber der Bolivarismus machte es phasenweise leichter.
Aus: ND