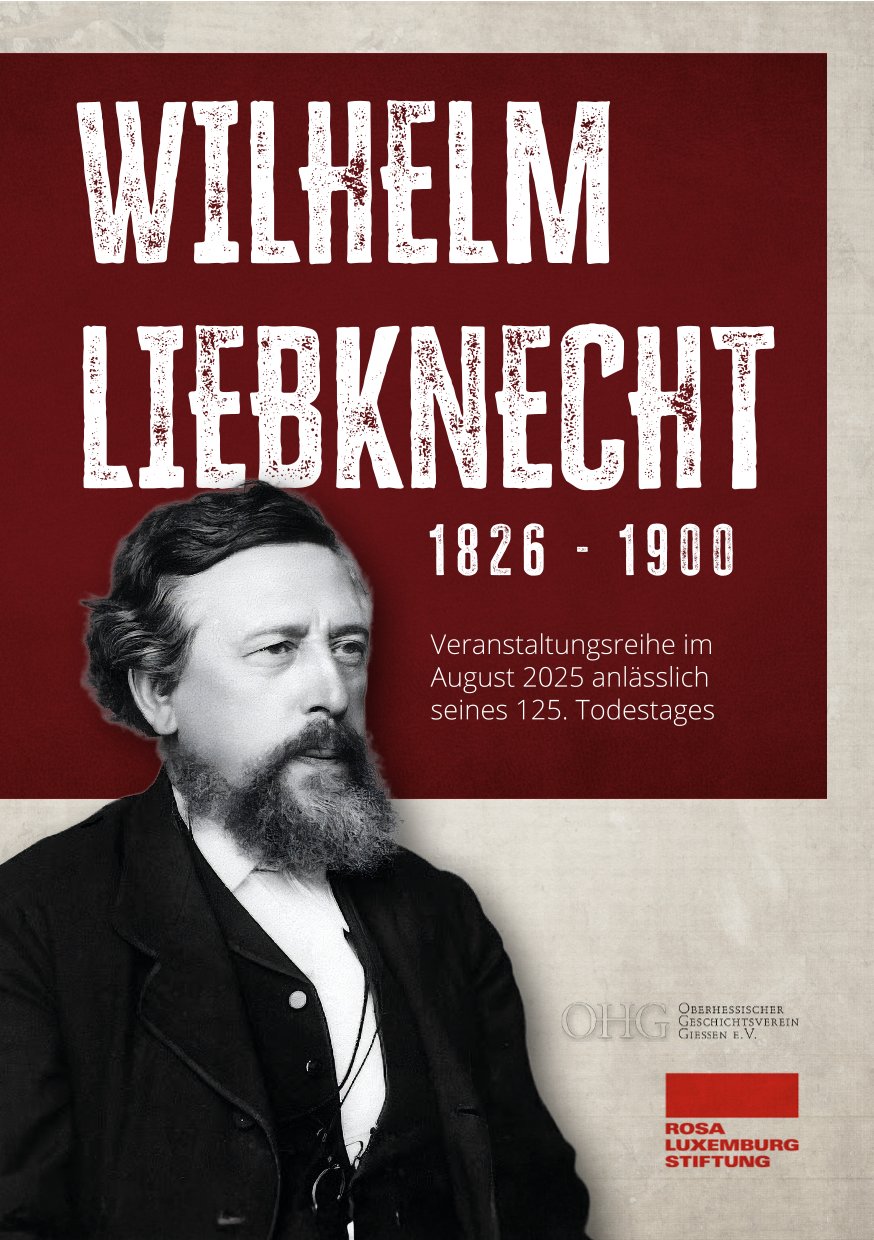Exot, Außenseiter, Spitzenreiter

Mit Bernie Sanders fordert Hillary Clinton ein sozialistischer US-Senator heraus
Barack Obama war 2008 der Spielverderber für Hillary Clinton. Diesmal könnte es, vorübergehend, Bernie Sanders werden. Ende April hat Bernard »Bernie« Sanders (73) seine Bewerbung für die Präsidentschaftskampagne 2016 angekündigt und für den Vorwahlkampf die Favoritin der Demokraten, Ex-First Lady, Ex-Senatorin und Ex-Außenministerin Hillary Clinton (67) ausgeguckt. Ihr will Sanders – als Parteiloser im Senat, aber den Demokraten angeschlossen – die Nominierung streitig machen.
Das wird am Ende wohl nicht klappen. Dafür fehlt ihm das Geld, ohne das die US-Demokratie heute noch weniger zu bewegen ist als früher. Ihm fehlen der Apparat, die Beziehungen und auch die Hoffnung, den Shitstorm des Establishments zu überstehen, je länger seine Kandidatur dauert, denn: Bernie Sanders, der Mann mit dem weißen Schopf und den wachen Augen, der Mann, der 1941 in New York als Sohn polnisch-jüdischer Einwanderer geboren wurde, ist das, was in den Vereinigten Staaten zuallerletzt sein darf, wer große Karriereträume hat – Sozialist.
Er weiß das, doch verzagt ist er deshalb nicht. Er ist lang Außenseiter gewesen. Vor seiner politischen Laufbahn sowieso, als er mit dunklen Hippie-Locken, Koteletten und Hornbrille in den sechziger Jahren als Zimmermann jobbt und für die alternative Zeitung »The Vermont Freeman« in Burlington, der größten Stadt des kleinen Bundesstaates an der kanadischen Grenze, arbeitet, in Chicago Politik studiert und einer der Studenten ist, die 1963 am »Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit« teilnehmen, bei dem Martin Luther King jr. bekennt: »I have a dream«.
Auch als Kommunal- und Bundespolitiker segelt Sanders nicht im Mainstream. Nicht in den vier Amtszeiten als Bürgermeister von Burlington. Nicht in seiner Parlamentstätigkeit in Washington, erst im Repräsentantenhaus (1991 bis 2007), wo er der längst dienende parteilose Kongressabgeordnete war. Und auch nicht im Senat, dem er seit 2007 angehört. Als ich ihn vor Jahren auf Capitol Hill traf, hat Sanders gegen den ersten Golfkrieg der USA gestimmt und viele gesetzgeberische Anläufe zur Verbesserung der sozialen Lage der kleinen Leute unternommen. Er führe, hieß es, höchst intelligent »beinahe einen Guerillakrieg«, um seinen Vorstößen Gehör zu verschaffen. Der »Almanach der Amerikanischen Politik« schrieb über den Linken aus dem Mini-Staat: »Die 90er Jahre werden als Dekade in die Geschichte eingehen, in der der Sozialismus in aller Welt eine Abfuhr erhielt – mit Ausnahme von Vermont.«
Sanders‘ Aussagen von damals unterscheiden sich wenig von seinen Forderungen heute. Der alte Guerillero will die Arm-Reich-Schere schließen. Er will den US-Mindestlohn auf 15 Dollar erhöhen (heute: 7,25), von den Reichsten und der Wall Street mehr Steuern holen und die sechs größten Banken aufspalten. In Madison (Wisconsin) zog Sanders kürzlich 10 000 Menschen an – so viele wie nie zuvor ein Bewerber im Vorwahlkampf. Er forderte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durch die Regierung, bessere Sozialversicherung und Entlastung für Studenten. »Die Vertreter des großen Geldes haben so viel Macht, dass kein Präsident sie besiegen kann, solange es keine organisierte Bewegung an der Basis gibt, die sie zu einer Vereinbarung zwingt. Die USA sind heute ein Staat, wo die obersten ein Prozent so viel besitzen wie die unteren 90 Prozent, wo die Zahl der Milliardäre ebenso wächst wie ihre Schamlosigkeit, Wahlen einfach zu kaufen. Das ist die Realität, und das kann so nicht weitergehen.«
Wer sich über seine Kernthemen hinaus ein Bild von dem Außenseiter machen will, wenigstens so viel: Sanders stimmte gegen den Irak-Krieg und warnte davor, dass sich die USA in Afghanistan ein zweites Vietnam einhandeln könnten. Der Kampf gegen den IS solle von Ländern wie Saudi-Arabien geführt werden. Er unterstützt die US-Sanktionen gegen Russland in der Ukrainefrage, Obamas Bemühungen um ein Nuklearabkommen mit Iran und lobt das griechische Volk für dessen Nein gegen das Verarmungsdiktat. Er sympathisiert mit Obama, illegale Einwanderer vor Deportation zu schützen, spricht sich aber für die Begrenzung von Gastarbeiterprogrammen aus, um die Jugendarbeitslosigkeit zu senken.
Bernie Sanders mag für die USA Exot sein – seine Themen sind es nicht. Sie gehen vielen Amerikanern unter die Haut. Das ist der eigentliche Grund für seinen Aufstieg in der Präsidentschaftskampagne. Er elektrisiert die linke Wählerbasis der Demokraten, will dafür sorgen, dass Clinton seine Themen nicht gänzlich ausspart und sie bis zur Nominierung nicht ohne Widerstand bleibt. Die Plattform Politico listete als »meistgelesen« einen Beitrag mit dem Titel »Die sozialistische Woge«: »Die Vorwahlen der Demokraten haben seit je liberale Rebellen nach vorn gebracht, aber noch nie so aufrührerische wie den Sozialisten-Senator aus Vermont. Er hat sich de facto als Herausforderer Hillary Clintons etabliert.« Bill Clintons Arbeitsminister Robert Reich vergleicht Sanders mit den einstigen Bewerbern Eugene McCarthy und George McGovern: »Bernie sagt, was er denkt. Unwahrscheinlich, dass er künftig nochmal kandidieren kann. Deshalb geht er aufs Ganze, redet Klartext.«
Rainer Oschmann, 25.07.15, nd