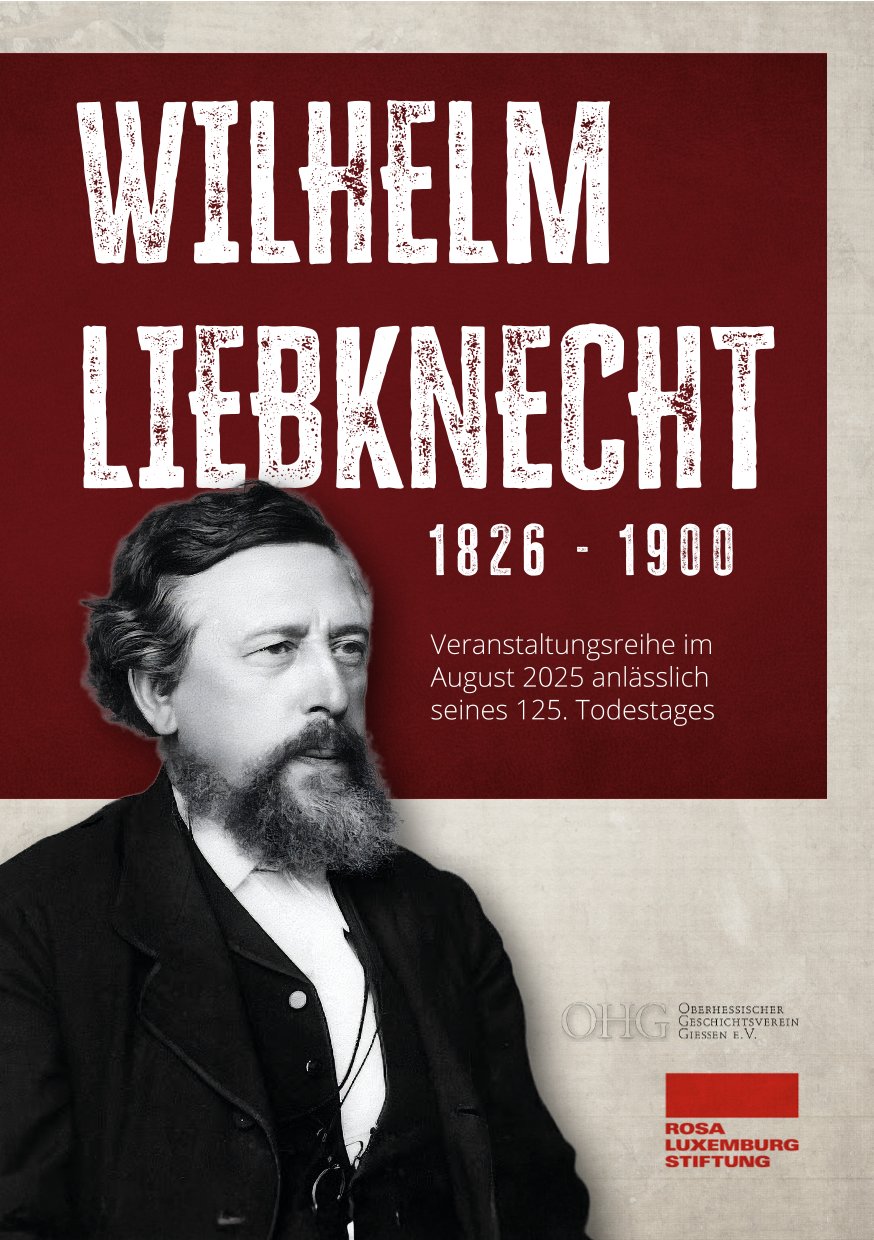Hauptsache Abwehr

Deutsche Kolonialverbrechen in Afrika: Berlin versucht weiter mit allen Mitteln, Entschädigungsforderungen abzuschmettern
Es geht um 30 Milliarden US-Dollar. Das ist die Summe, die die Regierung Namibias laut Medienberichten derzeit von Deutschland zu fordern prüft – als Entschädigung für die Verbrechen des Deutschen Reichs in seiner Kolonie Deutsch-Südwestafrika, vor allem für den Genozid an den Herero und den Nama. Noch ist nicht klar, ob Windhoek diesen Anspruch auch anmelden wird. Doch schon die Überlegung hat in den vergangenen Wochen in verschiedenen Ländern Afrikas für Schlagzeilen gesorgt – und Berlin spürbar verstört.
Der Druck auf die Bundesregierung wächst, sich in puncto Entschädigung für deutsche Kolonialverbrechen endlich zu bewegen. Anfang Januar haben Vertreter der Herero und der Nama bei einem US-Gericht in New York eine Sammelklage eingereicht, um Berlin zur Zahlung von Kompensationen für Landraub, Mord und den deutschen Genozid an ihren Vorfahren zu zwingen. Im Februar hat der Verteidigungsminister Tansanias, Hussein Mwinyi, mitgeteilt, die Regierung seines Landes stimme sich zur Zeit ebenfalls über mögliche Entschädigungsforderungen gegenüber der Bundesrepublik ab. Dabei geht es vor allem um den »Maji-Maji-Krieg« 1905 bis 1908, in dem die Deutschen in ihrer Kolonie Deutsch-Ostafrika weit über 100.000 Menschen umbrachten. Im März haben die Herero und die Nama einen ersten kleinen Teilerfolg errungen: Das New Yorker Gericht ist zu der Auffassung gekommen, dass ihre Forderungen gründlich geprüft werden müssen. Es hat daher beschlossen, das Verfahren weiterzuführen und für den 21. Juli eine zweite Anhörung anberaumt. Außerdem hat im März die Regierung Namibias mitgeteilt, sie ziehe ihrerseits eine Klage gegen Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag in Betracht. In Medienberichten ist dabei von den erwähnten 30 Milliarden US-Dollar die Rede.
Für die Bundesregierung kommen die neuen Forderungen sehr ungelegen: Sie drohen den Kurswechsel bei der Abwehr von Entschädigungsforderungen, den Berlin in der laufenden Legislaturperiode eingeleitet hat, scheitern zu lassen. Der Kurswechsel sollte es ermöglichen, einen Schlussstrich unter die Entschädigungsfrage zu ziehen. »Rot-Grün«, die erste große Koalition und Schwarz-Gelb hatten stets die alte Linie des Auswärtigen Amts umgesetzt, zu leugnen und sich total zu verweigern: Der Tatbestand des Genozids an den Herero und Nama wurde, wenn auch ohne die Verbrechen an sich in Abrede zu stellen, nicht anerkannt. Zugleich war man strikt darauf bedacht, nicht nur Entschädigungen, sondern auch jede Entschuldigung für die Verbrechen zurückzuweisen. Eine Entschuldigung könne als Schuldeingeständnis gewertet werden und den Druck, Entschädigungen zu zahlen, noch verstärken, hieß es. Als dies in Namibia immer stärkeren Unmut hervorrief, versuchte sich die damalige Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) im August 2004 an einer diplomatischen Gratwanderung: In einer Rede bei den Gedenkveranstaltungen zum 100. Jahrestag des Genozids bat sie »um Vergebung unserer Schuld«, betonte aber, dies explizit »im Sinne des gemeinsamen ›Vater unser‹« zu meinen. Der zugrundeliegende Gedanke war wohl, dass das »Vaterunser« ebensowenig Rechtsfolgen für Staaten hat wie das fünfte Gebot (»Du sollst nicht töten«). So jedenfalls interpretiert es auch das Auswärtige Amt.
Im Laufe der Zeit ergaben sich allerdings zwei Probleme. Das erste: Die Herero ließen sich nicht mit religiösen Reuebekundungen abspeisen und hielten an ihren Forderungen fest. Nun hätte man das einfach aussitzen können. Berlin hat darin ja Routine – man denke etwa an die Abwehr griechischer Forderungen nach Entschädigung für Massaker der Nazis im Zweiten Weltkrieg. Hinzu kam aber ein zweites Problem. Vier Kenianer, die die brutale Niederschlagung des Mau-Mau-Aufstandes in den 1950er Jahren durch die britische Kolonialmacht überlebt hatten, hatten sich in London das Recht auf Entschädigung erstritten. Im Juni 2013 sah sich die britische Regierung gezwungen, insgesamt 5.228 Opfern eine Entschädigung zuzusagen. Die Gesamtsumme belief sich auf 19,9 Millionen Pfund. Inzwischen sind in London weitere Klagen eingereicht worden; es gibt Hoffnung, dass noch mehr Opfer entschädigt werden. Den Nachkommen der Opfer deutschen Kolonialterrors in Namibia und in Tansania gibt das Zuversicht.
Die zweite große Koalition hat sich daher der Sache angenommen und die Suche nach einem möglichst billigen Weg aus der Affäre begonnen. Ihre Strategie enthält drei Elemente. Erstens sollen Bundespräsident und Bundestag den Tatbestand des Genozids anerkennen und sich entschuldigen, allerdings ausdrücklich nicht im rechtlichen, sondern im politisch-moralischen Sinne. Das soll wohl etwas Druck aus dem Dampfkessel nehmen. Zweitens stellt Berlin Mittel für eine deutsch-namibische »Zukunftsstiftung« bereit, um die Verbrechensgeschichte aufzuarbeiten. Das hätte für die Opfer wohl ein Fortschritt sein können, wäre es nicht mit dem dritten Element verbunden: Die Regierung Namibias soll ausdrücklich auf sämtliche Entschädigungsforderungen verzichten. Deshalb sind Vertreter der Herero und der Nama, die dazu nicht bereit sind, von den Verhandlungen ausgeschlossen worden, die Ruprecht Polenz (CDU), ehedem Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, seit 2015 im Auftrag der Bundesregierung mit Windhoek führt. In diesem Kontext wäre auch die »Zukunftsstiftung« nicht mehr als ein repressives Instrument, um die Entschädigungsforderungen loszuwerden. Zugespitzt ausgedrückt: Deutsche Akademiker würden für Forschungsprojekte zur Kolonialpolitik und für die Konzeption von Gedenkstätten bezahlt, während die Nachkommen der Opfer mit warmen Worten herzlichen Beileids kostenfrei abgespeist würden.
Bislang allerdings geht auch die neue deutsche Strategie zur Abwehr nicht auf. Die namibische Regierung ist vor allem durch die Klagen der Herero so stark unter Druck geraten, dass sie dem Ansinnen Berlins noch nicht zugestimmt hat. Wenn sie jetzt sogar zumindest erwägt, auch ihrerseits Entschädigungen zu fordern, dann zeigt das: Vielleicht ist in der Entschädigungsfrage das letzte Wort doch noch nicht gesprochen.
Jörg Kronauer, jw, 19.04.17
Der Genozid, den die deutschen Kolonialtruppen in Deutsch-Südwestafrika an den Herero und den Nama begingen, ist im öffentlichen Bewusstsein inzwischen halbwegs präsent. Weithin vergessen sind hingegen die fürchterlichen Massaker in Deutsch-Ostafrika, die eine noch größere Zahl an Menschen das Leben kosteten.
Das Morden begann dort bereits mit den »Strafexpeditionen« der 1890er Jahre. Die deutschen Kolonialisten bekämpften alle, die sich nicht unterwarfen, mit brutalsten Mitteln, brachten sie um, raubten, um den Widerstand zu brechen, der Zivilbevölkerung Vieh und Wertgegenstände, brannten ganze Dörfer nieder. Die »deutschen Methoden der Kriegführung« hätten sich damals »beträchtlich« geändert, resümierte der Historiker Jan Bart Gewald. Die »Aufstandsbekämpfung«, die Strategie der verbrannten Erde, habe zur »Entvölkerung« ganzer Landstriche geführt. Die Brutalisierung des Krieges in Afrika spürten auch deutsche Militärs. Er habe Krieg »in Böhmen und in Frankreich in der Praxis« kennengelernt, schrieb der preußische Offizier Eduard von Liebert, der 1896 in den Dienst der »Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika« trat. Was jetzt aber in der Kolonie geschehe, stelle alles Frühere in den Schatten.
Im Juli 1905 führte schließlich eine exzessive Erhöhung der brutal abgepressten Steuern zu offenem Aufruhr: Aufstände gegen die Deutschen breiteten sich vor allem im Süden und im Zentrum des heutigen Tansanias aus. Befeuert wurde die Rebellion zusätzlich durch den Glauben, man verfüge über eine Mixtur, ein »Wasser« (Swahili: »maji«), das unverwundbar mache. Dem war aber leider nicht so; die Aufständischen fielen in Massen deutschen Gewehrkugeln zum Opfer. Und die Deutschen trieben ihre Aufstandsbekämpfung bis zum Exzess: »Nach meiner Ansicht kann nur Hunger und Not die endgültige Unterwerfung herbeiführen«, erklärte Hauptmann Curt von Wangenheim. Die Deutschen selbst bezifferten die Zahl der Todesopfer mit rund 75.000. Heutige Geschichtswissenschaftler gehen von mindestens 180.000 aus. Der tansanische Historiker Gilbert Gwassa, ein Pionier der Erforschung des Maji-Maji-Kriegs, kam sogar auf 250.000 bis 300.000 Opfer – ein Drittel der Bevölkerung im Kriegsgebiet. (jk)